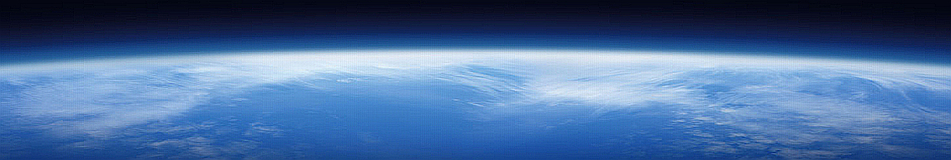Oberst Hofrichter, Leiter der MfS-Behörde in Lauterberg hat eine hübsche Tochter, kaum 18, mit kupferrotem Haar. Leider sind die Gedanken im Kopf darunter nicht unter Kontrolle zu bringen. Noch ein Problem, das mit der Stasi nicht aussterben wird.
Oberst Hofrichter, Leiter der MfS-Behörde in Lauterberg hat eine hübsche Tochter, kaum 18, mit kupferrotem Haar. Leider sind die Gedanken im Kopf darunter nicht unter Kontrolle zu bringen. Noch ein Problem, das mit der Stasi nicht aussterben wird.
Neuerliche Inspektion ihres Zimmers hatte rote Nebel der Wut in seinen Kopf getrieben: Silvia wollte nicht lassen von der Verführung durch ein feindlich-negatives Subjekt. Begonnen hatte das Anfang der siebziger Jahre, sie war gerade sechzehn, vorigen Sommer hatte sie den Abschaum wiedergesehen, bei den Weltfestspielen in Berlin. Es waren Briefe gewechselt worden, nun war gar ein Foto aufgetaucht. Er hatte darauf vertraut, dass die Entfernung die Leidenschaft erkalten ließe, hatte keine Reisen nach Berlin erlaubt, Ausgangssperren verhängt, sobald die operativ kontrollierte Person in Lauterberg zu erscheinen drohte. Es hatte nicht geholfen, das Kind wurde aufsässig.
Schlimmer noch, dass ein Schreiben aus Berlin eingegangen war, den Horbel, Gustav, betreffend. Er hatte sich zum Komplizen eines Westberliner Schreiberlings gemacht, eine HS-Beziehung höchstwahrscheinlich. Nachfragen kamen aus der Hauptstadt, „ob und inwiefern der Observierte … “; natürlich gab es einen Vorlauf. Hofrichter hatte die Akte kommen lassen. Der Knabe war mit vierzehn notorisch: Kirchgänger, feindlich-negative Einstellung, verweigert die Werbung als Reserveoffizier der NVA, fällt bei schulischen Veranstaltungen durch bürgerliche Abweichungen auf, letzter Höhepunkt 1969: eine westlich-pennälerhafte Abiturzeitung mit dem Titel „Mülldeckel“, verdiente Genossen Lehrer darin verspottet, ein mindestens ebenso unverschämter, dieselben parodierender Auftritt beim Abiturball.
Sie hatten die Schulleitung dafür maßgenommen, dass sie den Horbel überhaupt zuließ zum Studium. Aber eigentlich waren dann alle froh, dass er weg war, er selbst, Hofrichter, am meisten. Mochten sich die Genossen in der Hauptstadt mit dem Abschaum herumärgern. Doch nun kam das Problem gleich zwiefach zurück, als offizieller Vorgang und Familienzwist, ein Scheißproblem.
Als er hörte, wie sich die Wohnungstür schloss, der leichte Schritt der Tochter sich über den Korridor näherte, begann der Oberstleutnant, auf den Stiefelspitzen zu wippen. Er wandte sich nicht um, als sie das Wohnzimmer betrat, presste die Lippen aufeinander, als sie hallote. Er schwieg.
„Ist was?“
Das Wippen verhielt, Verachtung zischte durch die Zähne: „Was ist? Schluss ist, Schluss mit meiner Geduld!“