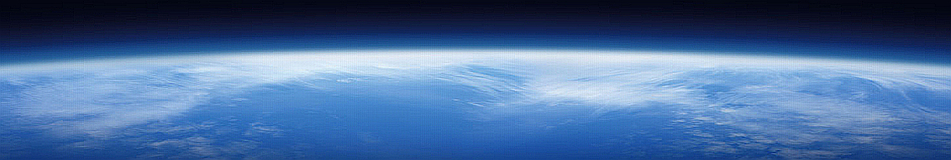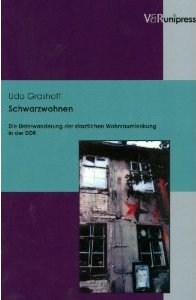Matthias Montag, Offizier im besonderen Einsatz beim Fernsehen der DDR, hat sich einer eigenen Form der Nachwuchsförderung verschrieben und braucht, um den jungen Damen zu imponieren, eine Lebensgefährtin zum Herzeigen. Der Zufall kommt ihm zu Hilfe – in der Gestalt von “Frau Elster”
Im Casino des Fernsehens erregte sich eine prominente Schauspielerin darüber, dass „die strohdämliche Frau Elster“ nicht nur mit einer Gesangsausbildung im Fach Chanson an der Musikhochschule, sondern auch mit einem nigelnagelneuen Auto bedacht worden sei, obwohl sie weder stimmliche Begabung noch die von Autokäufern im Sozialismus zu absolvierenden Wartejahre habe vorweisen können. Matthias wurde hellhörig. Dass „Frau Elster“ der Spitzname einer Eiskunstläuferin war, wusste er: Sie hatte in den sechziger Jahren etliche Medaillen gewonnen, nach einer unglücklichen Affäre mit einem Kanadier Federn lassen müssen, sich einem Kollegen ver- und entlobt, schließlich den Sohn eines Lederwarenhändlers aus Lauterberg geheiratet. Die Ehe war ebenso verunglückt wie alle sängerischen und schauspielerischen Versuche dieser Katja Günzler – der Spitzname verriet es. Matthias Montag stellte sich vor, wie die einstmals Umjubelte sich fühlen musste, während kübelweise Häme sich über sie ergoss. Der Frau könnte geholfen werden, dachte er sich, denn ihre Rachegefühle waren zu befriedigen, das Bedürfnis nach Trost, die Sucht nach Bewunderung zu stillen. Er rief sie an.
„Hallo“, tönte es aus dem Hörer, „wer ist da bitte?“
„Guten Tag, gnädige Frau“, Mathias schluckte am eigenen Schleim, „verzeihen Sie bitte den Überfall, aber meine Genossen vom Fernsehen haben mich ein wenig … nun, wie soll ich sagen … verärgert durch ihren Mangel an Sensibilität im Umgang mit Ihnen. Montag mein Name, Matthias Montag. Ich bin ein Fan, ein langjähriger Verehrer, wenn ich so sagen darf, und es schmerzt mich zu sehen, wie Sie von neidischen, missgünstigen Leuten verfolgt werden. Glücklicherweise kann ich dem aufgrund meiner Position in Adlershof entgegentreten.“
„Da sinn Se Gott sei Dank ni dor Eenzsche!“, kam es zurück, „un was wolln Se jetze von mir?“
„Ich bin zu einem Empfang beim Genossen Minister eingeladen, es wäre mir eine Ehre, wenn Sie mich begleiteten.“ Das war eine glatte Lüge, aber sie machte Eindruck.
„Isch kenn Sie doch gor ni. Minister. Welscher denn? Kultur oder …?“
„Maschinenbau“, Matthias beglückwünschte sich zu der Eingebung. „Ministerium für Allgemeinen Maschinen-, Landmaschinen- und Fahrzeugbau. Wir vom Fernsehen haben ja einen großen eigenen Fuhrpark und deshalb besondere Beziehungen zum Ministerium, Sie verstehen. Verzeihen Sie – es ist gewissermaßen ein Traum für mich, bei einer solchen Gelegenheit in Ihrer Begleitung … und es wäre ja für Sie auch durchaus interessant, wenn ein offizieller Vertreter des Fernsehens mit Ihnen aufträte, nicht wahr. Der Genosse Intendant sieht das übrigens ebenso.“ Mit der Kühnheit des letzten Satzes schwang sich Matthias Montag auf eine Höhe, für die er sich selbst bewunderte. Es konnte ihm das Genick brechen, falls Frau Elster je mit Heinz Adameck darüber sprach. In der Leitung blieb es still, der Moment dehnte sich unerträglich, Furcht kroch ihm in die Kehle – was, wenn sie auflegte?
„Nu, da solltn mr uns obr vorhär schon emol beschnubbrn, odr?“
„Das hatte ich kaum zu hoffen gewagt – nun, da Sie es vorschlagen: je eher, je lieber! Wann passt es Ihnen denn?“
„Donnerstag um Fünfe im Café vom Ballasthotel. Woran erkenn ich Sie?“
„Ich bin ganz sicher vor Ihnen da, liebe Frau Günzler und komme auf Sie zu – vielen, vielen Dank, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie ich mich freue!“