 Atemlos habe ich über 500 Seiten aufgesogen, wie im Rausch. Darf ein Rezensent das? Vielleicht bin ich gar keiner. Nicht, wenn für das Besprechen eines Buches eine „Objektivität“ verlangt wird, die akademische Gelehrsamkeit zur Voraussetzung hat. Noch weniger, wenn politische, moralische, religiöse Neutralität – wie auch immer sie definiert sei – beim Lesen gefordert wäre. Dem Autor und seinen Texten gegenüber bin ich voreingenommen. Ich habe „Fräulein Hallo und der Bauernkaiser“ ebenso verschlungen wie „Für ein Lied und hundert Lieder“ , und „Die Wiedergeburt der Ameisen“; 2011 entstand mein Radiofeature „Für China aus dem Exil“, als Liao Yiwu seiner feindseligen Heimat China entkam. Aus der öffentlich-rechtlichen Mediathek ist es verschwunden, die Redakteurin fand seinerzeit schon Liaos Texte narzisstisch und unappetitlich, war dann vom Live-Gesang, von der Intensität des Gedichts „Massaker“ über den 4. Juni 1989 auf dem Tian’anmen, vom Alltag der Folter im chinesischen Gefängnis so perhorresziert, dass sie mich gewähren ließ.
Atemlos habe ich über 500 Seiten aufgesogen, wie im Rausch. Darf ein Rezensent das? Vielleicht bin ich gar keiner. Nicht, wenn für das Besprechen eines Buches eine „Objektivität“ verlangt wird, die akademische Gelehrsamkeit zur Voraussetzung hat. Noch weniger, wenn politische, moralische, religiöse Neutralität – wie auch immer sie definiert sei – beim Lesen gefordert wäre. Dem Autor und seinen Texten gegenüber bin ich voreingenommen. Ich habe „Fräulein Hallo und der Bauernkaiser“ ebenso verschlungen wie „Für ein Lied und hundert Lieder“ , und „Die Wiedergeburt der Ameisen“; 2011 entstand mein Radiofeature „Für China aus dem Exil“, als Liao Yiwu seiner feindseligen Heimat China entkam. Aus der öffentlich-rechtlichen Mediathek ist es verschwunden, die Redakteurin fand seinerzeit schon Liaos Texte narzisstisch und unappetitlich, war dann vom Live-Gesang, von der Intensität des Gedichts „Massaker“ über den 4. Juni 1989 auf dem Tian’anmen, vom Alltag der Folter im chinesischen Gefängnis so perhorresziert, dass sie mich gewähren ließ.
Was mir im Interview mit Liao Yiwu auffiel: Der Kontrast zwischen seinem zurückhaltenden und bescheidenen Auftreten und der ungeheuren Anmaßung seines Schreibens: Er fordert die Politbürokratie Chinas heraus, die nicht nur über ein Milliardenvolk gebietet, sondern auch das Netzwerk globaler Diplomatie fast nach Belieben steuern kann. Die Ameise auf dem Rücken des Elefanten fällt mir ein, und das Heer der Ameisen, die „Würg ihn! Würg ihn!“ rufen. Das Heer sind wir: Autoren aus aller Herren Länder, ältesten und modernsten, technisch hochgerüsteten Despoten ausgeliefert, ein Heer, das Namen aus Jahrtausenden versammelt. Sie haben fast alle Schlachten verloren, noch die bedeutendsten, mutigsten mussten bisweilen zu Kreuze kriechen. Das Bild der zähen Insekten – in der Masse kaum unterscheidbar, reproduzieren sie sich in verborgenen Labyrinthen, kommen aber überall hin – dieses Bild erscheint bei Liao Yiwu öfter. Seine Ameisen haben Gesichter.
Sein neuestes Buch nimmt den Leser mit in die Labyrinthe, auf eine atemlos mäandernde Reise zwischen Peking und Chinas südwestlichen Provinzen Sichuan und Yunnan unter beständigem Verfolgungsdruck der Sicherheitsbehörden. Liao Yiwu schweift dabei immer wieder in die Tiefen der chinesischen klassischen Literatur- und Religionsgeschichte ab, sucht nach Vergleichen zu Fluchtschicksalen von Philosophen – etwa des großen Kong Fuzi – trifft auf Gefährten des Widerstandes. Mit manchen hat er den Folterknast geteilt. Manche haben sich den Zwängen und Verlockungen der Politbürokraten und ihrer „sozialistischen Marktwirtschaft“ ergeben, in der alles, auch Religionen und kulturelle Traditionen von Minderheiten, käuflich und verkäuflich ist. Die meisten überleben in Not und unter abenteuerlichen Umständen, sie saufen, fressen, spielen Versteck mit Spitzeln und Polizei – um den Preis des Lebens. Es ist eine lange Reihe von Namen, prägnanten Charakteren, erschütternden Schicksalen. Auch das von Lao Yiwus Familie gehört dazu. Seine Mutter hilft, obwohl sie die Repressionen mit erdulden muss, dem Sorgenkind immer wieder ins Gewissen redet. Es helfen schließlich viele aus dem Ausland, die seine Bücher schätzen und sie weltweit verbreiten wollen. Zwischen Hoffen und Verzweifeln erleben wir den Weg des Autors in die Freiheit, er balanciert zwischen Abgründen, und obwohl der gute Ausgang bekannt ist, bleibt das spannend bis zum letzten, erlösenden Augenblick im Sommer 2011.
Ja: Auch in dieser Fluchtgeschichte wird es oft unappetitlich, und der Vorwurf narzisstischer Selbstüberhöhung dürfte von jenen ertönen, die harmonisches Dazugehören vorziehen, radikal agierende Schmutzaufwirbler gern am Rand des Pathologischen verorten. Davon wird sich Liao Yiwu kaum beeindrucken lassen, und das ist eine Hoffnung für die Ameisen im Untergrund der „harmonischen Gesellschaft“, wie sie die KP Chinas verkündet. Der Schriftsteller ruht sich in Deutschland ebensowenig aus wie andere Exilanten. 2014 kam seine jüngste Tochter hier zur Welt, und es sieht danach aus, dass sie sein Lesen und Schreiben für die Freiheit weiter anspornt.
Brigitte Höhenrieder und Hans Peter Hoffmann haben bewundernswert übersetzt, sie erarbeiteten schon die deutsche Fassung von „Fräulein Hallo und der Bauernkaiser“. Ihnen sei ebenso Respekt gezollt, wie dem langjährigen Lektor Peter Sillem – seit 2017 ist er Galerist – und dem S. Fischer Verlag, der Liao Yiwu jederzeit den Rücken frei hielt.
Liao Yiwu „Drei wertlose Visa und ein toter Reisepass – Meine lange Flucht aus China“
S. Fischer Verlag 2018, 528 Seiten, 26,80€
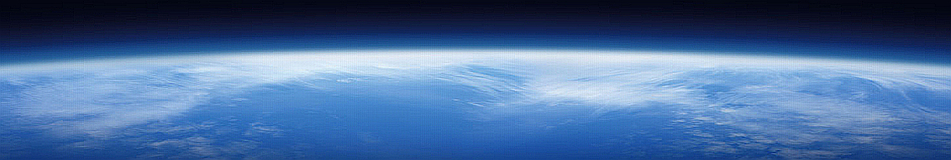




 Der letzte Sturm hat ein paar große alte Bäume umgeweht. Unterm Wurzelwerk der 130jährigen Ulme hat Herr Amsel ein Versteck mit Nahrungsreserven gefunden, aus dem er mich skeptisch beäugt. Den Winterlingen ist egal, dass ihnen der Boden unter den Füßen weggekippt ist: So kriegen sie noch mehr Sonne und blühen einfach: Nächste Woche, sagen die Meteorologen, gibt’s Frost und Schnee, aber vermutlich wissen Frühjahrsblüher dank ihres eigenartigen vegetativen Gedächtnisses, dass solche Intermezzi in Baden-Baden kurz sind. Sie haben sie noch immer überstanden.
Der letzte Sturm hat ein paar große alte Bäume umgeweht. Unterm Wurzelwerk der 130jährigen Ulme hat Herr Amsel ein Versteck mit Nahrungsreserven gefunden, aus dem er mich skeptisch beäugt. Den Winterlingen ist egal, dass ihnen der Boden unter den Füßen weggekippt ist: So kriegen sie noch mehr Sonne und blühen einfach: Nächste Woche, sagen die Meteorologen, gibt’s Frost und Schnee, aber vermutlich wissen Frühjahrsblüher dank ihres eigenartigen vegetativen Gedächtnisses, dass solche Intermezzi in Baden-Baden kurz sind. Sie haben sie noch immer überstanden.






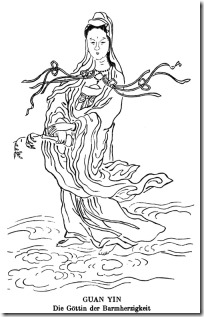
![Erwin_Schrödinger[2] Erwin_Schrödinger[2]](https://raketenschirm.com/wp-content/uploads/2016/11/erwin_schrc3b6dinger2_thumb.jpg?w=189&h=244)